Die Instrumentalisierung des Schulddiskurses in Max Frischs Andorra – Teil I
4. Juli 2016 - 2016 / Allgemein / texttext
Max Frischs Drama Andorra (1961) wird im deutschsprachigen Raum gleichermaßen geschätzt und verachtet und sorgt zwischen Wissenschaftler_innen noch immer für Uneinigkeit darüber, wie es zu verstehen ist.1)Petersen, Jürgen H.: Max Frisch. 3. Auflage, Stuttgart [u.a.]: J.B. Metzler 2002, S. 70. Nach einer Phase der intensiven Auseinandersetzung mit dem Werk bis zur Mitte der 80er Jahre2)Frisch, Max: Andorra. Text und Kommentar. 18. Auflage, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 2013, S. 151. scheint das wissenschaftliche Interesse seit nunmehr gut zwei Jahrzehnten fast vollkommen erloschen zu sein.3)Castellari, Marco: Max Frisch: Andorra (1961). In: Handbuch Nachkriegskultur. Literatur, Sachbuch und Film in Deutschland (1945-1962). Hrsg. von Elena Agazzi u. Erhard Schütz. Berlin [u.a.]: De Gruyter 2013, S. 321-324; hier: S. 321. Warum es trotzdem konstruktiv ist, sich erneut mit dem Klassiker der deutschsprachigen Literatur zu beschäftigen, beweist ein kritischer Blick auf die Verarbeitung der ‚Deutschen Schuld‘ innerhalb des Werks.
Obgleich sich Andorra in das große Korpus kreativer Literatur des 20. Jahrhunderts einreiht, in dem die Not der Juden in einem feindlichen, nicht jüdischen Umfeld geschildert wird,4)Löb, Ladislaus: ‚Insanity in the Darkness‘: Anti-Semitic stereotypes and Jewish identity in Max Frisch’s Andorra and Arthur Miller’s Focus. Modern Language Review, Vol. 92, No. 3 (Jul. 1997), S. 545-558; hier: S. 545. ist die Bedeutung des Schulddiskurses innerhalb des Werks problematisch zu sehen. Nachstehend wird dies anhand der folgenden These erörtert:
Der Schulddiskurs wird in Max Frischs Drama Andorra zur Darstellung der Bildnisthematik instrumentalisiert.
Es ist im Folgenden zu klären, in welchem Verhältnis die beiden Aspekte zueinanderstehen und inwiefern der Schulddiskurs nur dazu benutzt wird, Frischs beliebte Bildnisthematik zu vermarkten und sie für eine breite Masse interessant zu gestalten. Nicht umsonst ist Andorra – Frischs größter Bühnenerfolg und Grundstein für seine „Karriere als zeitkritischer Dramatiker der Nachkriegszeit“5)Castellari: Max Frisch, S. 321. – in zeitlicher Nähe zum Eichmann-Prozess veröffentlicht worden.
In den kommenden drei Wochen soll der Frage nach der Verarbeitung der deutschen Schuld in Andorra anhand drei zentraler Aspekte nachgegangen werden: Bildnisthematik, Modell vs. Zeitgeschichte und antisemitische Tendenzen.
Teil I: Die Bildnisthematik
„Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf der Erde, oder des, das im Wasser unter der Erde ist“6)Ex 20:4 heißt es im zweiten Buch Mose. Für Max Frischs literarisches Schaffen ist diese Bibelstelle von paradigmatischer Bedeutung. Das Bildnis ist ein wiederkehrendes Thema,7)Soennecken, Stefanie: Die Bildnisthematik bei Max Frisch. Das Bildverständnis in den Werken Andorra und Homo faber. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung 2011, S. 18 das auch in Homo Faber, Stiller und Mein Name sei Gantenbein eine zentrale Position einnimmt. Grundlegende Aspekte zum Verständnis von Frischs Bildnistheorie finden sich in seinem Tagebuch 1946-1949:
„Du sollst dir kein Bildnis machen, heißt es, von Gott. Es dürfte auch in diesem Sinne gelten: Gott als das Lebendige in jedem Menschen, das, was nicht erfaßbar ist. Es ist eine Versündigung, die wir, so wie sie an uns begangen wird, fast ohne Unterlaß wieder begehen – Ausgenommen wenn wir lieben.“8)Frisch, Max: Tagebuch 1946-1949. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1950, S. 37.
Das Bildnis, nach Frischs Verständnis, verformt und verändert den Menschen, indem es ihn in seinen Bann zieht und fesselt. Der Mensch wird unfähig zur Wahl und verliert dadurch seine Freiheit.9)Lüthi, Hans Jürg: Max Frisch. 2. Auflage, Tübingen [u.a.]: Francke 1997, S. 46.
In Andorra erfährt Frischs Bildnistheorie ihre „konsequente dramatische Ausgestaltung“.10)Ebd., S. 46-47. Als Keimzelle des Dramas kann die Prosaskizze Der andorranische Jude (1946) festgehalten werden, die im Tagebuch 1946-1949 niedergeschrieben ist.11)Frisch: Andorra, S. 136. Der Eintrag enthält neben Bemerkungen zum Inhalt auch die grundlegenden Motive des späteren Dramas: Bildnis und Identität.
Perspektivwechsel
Die Wandlung des Titels von Der andorranische Jude zu Andorra ist Indiz für die veränderte Schwerpunktsetzung. Im Mittelpunkt steht nicht mehr der Jude, sondern der Staat Andorra, das Kollektiv, das Vorurteile hervorbringt.12)Soennecken: Die Bildnisthematik, S. 30. Dem Protagonisten Andri wird bereits über seinen Namen seine Andersartigkeit zugeschrieben und diese Eigenschaft durch die Andorraner zusätzlich verstärkt. Durch die Zuschreibung vorurteilsmäßig ‚jüdischer Eigenschaften‘, wie Geldgier, Feigheit, Ehrgeiz, Intelligenz, Gemütslosigkeit,13)Vgl. Frisch: Andorra, S. 21, S. 22, S. 39, S. 25. wird Andri vom Individuum zum typischen Vertreter einer vorurteilsbehafteten Gruppe.14)Ebd., S. 35. In Abgrenzung zu ihrem überhöhten Selbstbild entwerfen die Andorraner ein komplementäres, negatives Fremdbild von ihm.15)Ebd., S. 76.
Internalisierung
Obgleich die Zuschreibung bestimmter Charaktermerkmale von außen an Andri herangetragen wird, handelt es sich beim Bildnis in Andorra um eine „self-fulfilling prophecy“.16)Ebd., S. 28. Andris ständige Reflexion über die vermeintlich ‚jüdischen Eigenschaften‘ und die Überprüfung des eigenen Verhaltens im Hinblick auf ebendiese17)Ebd., S. 29. führen zur Internalisierung des stereotypen Fremdbildes. Die suggestive Wirkung des von den Andorranern kreierten Bildnisses erzwingt die eigene Verwirklichung18)Lüthi: Max Frisch, S. 8.
und lässt das Fremdbild schließlich zum Selbstbild werden.
Das Bildnis als Versündigung
Die bei Frisch angesprochene ‚Versündigung‘ besteht nicht im Bildnis selbst, sondern in dessen unreflektiertem Gebrauch19)Soennecken: Die Bildnisthematik, S. 21. – in diesem Sinne auch in Andris Internalisierung. Durch den unkritischen Umgang erstarren die den Bildnissen innewohnenden Denkmuster zu mit Vorurteilen behafteten Klischees.20)Lüthi: Max Frisch, S. 9. Eben dieser Prozess lässt sich in Andorra beobachten: Die Andorraner verwenden das stereotype Bildnis des Juden ohne kritische Überlegung und begegnen dem vermeintlichen Juden Andri mit Vorurteilen. Die fehlende Reflexion zeigt sich an zwei Aspekten besonders deutlich: Einerseits erkennen die Andorraner nicht, dass es sich bei den ‚typisch jüdischen Merkmalen‘ um die Projektion ihrer eigenen negativen Eigenschaften handelt, die wiederum aus unterschwelligen Ängsten und Aggressionen resultiert. Andererseits entspricht Andri dem gefertigten Bildnis nur, da er dieses aufgrund der suggestiven Wirkung internalisiert hat. Das Bild des Juden hat seinen Ursprung nicht im Charakter des ‚typischen‘ Vertreters, sondern der Charakter Andris entspringt der Internalisierung des von den Andorranern gefertigten Bildnisses. Nicht umsonst bezeichnet Frisch selbst Andorra als (Anfänger)Kurs in der Beschäftigung mit dem (Massen)Vorurteil, bei dem das Bewusstsein des Rezipierenden hinsichtlich der Verwendung von Bildnissen geschärft werden soll.21)Arnold, Heinz Ludwig: Gespräche mit Schriftstellern. München: Beck 1975, S. 37.
Das Vorurteil als „zentraler Wirkungsmechanismus des Dramas“22)Frisch: Andorra, S. 156.
Die Bildnisthematik, gleich ob als Fremd- oder Selbstbild, hat Max Frisch zeit seines Lebens beschäftigt und dadurch großen Einfluss auf sein literarischen Werke genommen. Die Zentralität der Thematik spricht dafür, dass es sich auch bei Andorra vordergründig um die erneute Abhandlung des bekannten Motivs handelt. Im Mittelpunkt steht dabei die verhängnisvolle Macht von Bildnissen,23)Ebd., S. 155. die sich in Gestalt der Zerstörung des Menschen als Hauptgegenstand bereits in der Tagebuchskizze Der andorranische Jude24)Lüthi: Max Frisch, S. 47. findet. Die Frage nach der Schuld, die in Andorra vornehmlich in der Zeugenschranke abgehandelt wird, bezieht sich auf die Versündigung der Andorrander durch das ‚Bildnis-Machen‘ und nicht – im Sinne einer Auseinandersetzung mit der ‚Deutschen Schuld‘ – auf die Verfolgung eines Juden. Ziel ist dabei nicht die abschließende Bewältigung des Nationalsozialismus und der daran anschließenden Schuldfrage, sondern vielmehr die „Auslösung von Bewusstseinsklärungsprozessen“.25)Petersen: Max Frisch, S. 71.
In der kommenden Woche soll das Spannungsverhältnis zwischen Modellcharakter und Zeitgeschichte im Hinblick auf den Schulddiskurs in Andorra betrachtet werden. Die Argumentation auf inhaltlicher Ebene – die Bildnisthematik – soll durch einen Blick auf die Form des Dramas erweitert werden.
- Release Maskulin*identität_en - 10. Januar 2018
- Guilty Pleasures: Weihnachtslieder-Edition - 23. Dezember 2017
- August Mackes Modegeschäft (1913): Die Kunst der Flanerie - 30. September 2017
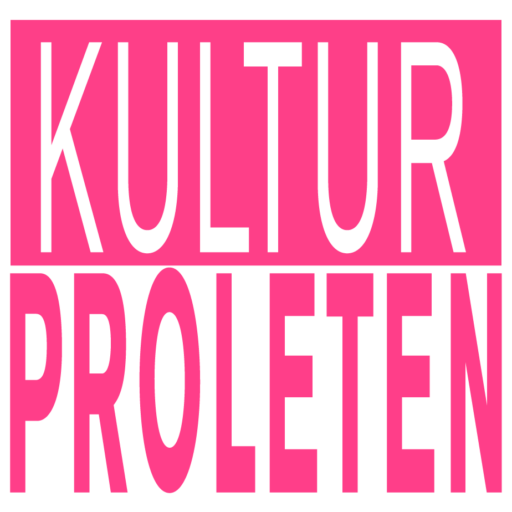
Schreibe einen Kommentar